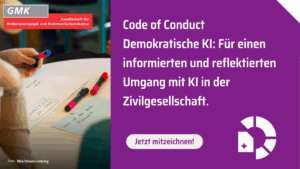Mitgliederumfrage 2025 der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur e.V. (GMK) in Kooperation mit dem Deutschen Kinderhilfswerk
Die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur e.V. (GMK) befragt im Rahmen einer jährlichen Umfrage ihre Mitglieder, darunter zentrale bundesweite Akteur*innen und Multiplikator*innen der Medienbildung, in Kooperation mit dem Deutschen Kinderhilfswerk (DKHW) zu ihrer Einschätzung und Haltung zu bedeutenden Herausforderungen und Zukunftsvisionen der Medienpädagogik.
Im Folgenden lesen Sie eine Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der Befragung. Eine ausführlichere Zusammenfassung und medienpädagogische Einordnung der Mitgliederumfrage 2025 finden Sie hier als PDF.
Nach der Auswertung der Mitgliederumfrage haben GMK und DKHW eine gemeinsame Pressemitteilung herausgegeben: „Verbotsdebatten zur Smartphonenutzung junger Menschen sind Augenwischerei – Medienkompetenz schon ab der Kita fördern“.
GMK-Co-Geschäftsführer André Weßel wurde dazu für einen Beitrag in der WDR-Sendung „Aktuelle Stunde“ interviewt und kommentierte: „Eine vernünftige Regulierung wäre nicht alleinstehend, sondern begleitet von medienpädagogischen Maßnahmen, von Medienerziehung und Medienbildung, am besten schon ab der Kita. Es bringt nichts, junge Menschen auszuschließen – mit 16 werden sie auf die sozialen Medien losgelassen und haben dann nie gelernt, wie sie damit umgehen.“
Die Pressemitteilung fand ein großes Medienecho und wurde u.a. von zdf.de, swr.de, heise.de sowie zahlreichen Printpublikationen aufgegriffen: Stuttgarter Zeitung, Münstersche Zeitung, Westdeutsche Zeitung, Westfalen-Blatt, Schwarzwälder Bote, Frankfurter Neue Presse, Freie Presse Chemnitz, Nürnberger Nachrichten, Die Oberbadische, Rhein-Neckar-Zeitung etc.
Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der Befragung
1. Aktuelle Themen der Medienpädagogik
Ein Kernresultat der Mitgliederumfrage verweist auf die Notwendigkeit, aktuelle gesellschaftliche Themen wie Künstliche Intelligenz und algorithmische Entscheidungssysteme, Politische Medienbildung sowie den Umgang mit Desinformation in die Medienpädagogik zu integrieren. Diese Themen lagen auch im vergangenen Jahr ganz oben im Ranking.
Relevant sind zudem für viele Akteur*innen die Themen Medienerziehung und Social Media. Hier zeigt sich, dass z.B. die Unterstützung von Eltern zu Fragen rund um die Smartphonenutzung ihrer Kinder sowie zu den sozialen Netzwerken als hochrelevant eingeschätzt werden. Die Aktive Medienarbeit, die ebenfalls von vielen Befragten genannt wurde, liefert hier erfolgreiche, lebensweltnahe Konzepte für die Arbeit mit jungen Menschen und ist eine der Stärken medienpädagogischer Arbeit. Sie zeichnet sich durch Handlungsorientierung aus und verknüpft mit einem starken Lebensweltbezug soziale, ethische, kulturelle, kreative und politische Aspekte mit technischem Knowhow. Im Zentrum steht, im Sinne einer kreativen und kritischen medienpädagogischen Arbeit ein gutes Aufwachsen mit Medien zu ermöglichen, Kinderrechte in der digitalen Welt zu stärken und Teilhabe, Partizipation und Selbstwirksamkeitserfahrungen sowie einen reflektierten und mündigen Umgang mit Medien zu ermöglichen.
Ebenfalls relevant sind Themen wie Hass im Netz, Kinder- und Jugendmedienschutz sowie Medienkapitalismus.
2. Maßnahmen, die Bund, Länder und Kommunen ergreifen sollten, um die genannten Themen zielführender bearbeitbar zu machen
Die Befragung verdeutlicht, dass eine wirksame Medienbildung nur durch langfristige und strukturierte Maßnahmen gewährleistet werden kann. Die Antworten der Akteur*innen lassen sich in sechs zentrale Handlungsfelder gliedern:
- Strukturelle Verankerung
Medienbildung muss verbindlich in allen Bildungsbereichen (Schule, Kita, Hochschule, außerschulische Bildung) festgeschrieben werden. Dazu gehört die Aufnahme in Lehrpläne, Rahmenrichtlinien und die Aus- und Weiterbildung von pädagogischem Personal. Medienpädagog*innen sollten als fester Bestandteil multiprofessioneller Teams wirken. - Nachhaltige Finanzierung
Anstelle projektbasierter Kurzförderungen braucht es langfristige und verlässliche Strukturen. Neben einer modernen technischen Ausstattung und leistungsfähiger Infrastruktur sind stabile Personalstellen, faire Arbeitsbedingungen und die Reform von Förderlogiken zentral, um Planungssicherheit zu schaffen. - Bürokratieabbau und Koordination
Förderverfahren müssen vereinfacht, Zuständigkeiten klar geregelt und bundesweite Qualitätsstandards etabliert werden. Länderübergreifende Zusammenarbeit sowie die Anbindung an europäische Strategien werden als notwendig erachtet. - Qualität und Bildungskonzepte
Medienbildung soll über Technikvermittlung hinausgehen und auch politische, kreative und gesellschaftskritische Dimensionen berücksichtigen. Themen wie Künstliche Intelligenz, Desinformation oder digitale Souveränität müssen gezielt aufgegriffen werden. Open Educational Resources (OER) gelten als Schlüssel zur chancengerechten und partizipativen Medienbildung. - Regulierung und Schutz
Plattformbetreiber müssen stärker in die Pflicht genommen werden, z. B. beim Jugendmedienschutz, Datenschutz und bei der Umsetzung von Altersverifikationen. Bildungseinrichtungen benötigen rechtliche Klarheit für den Einsatz digitaler Tools und neuer Technologien. - Öffentlichkeitsarbeit und gesellschaftliche Einbindung
Medienbildung soll als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sichtbar gemacht und eng mit Demokratiebildung verknüpft werden. Notwendig sind eine bundesweite Bildungsoffensive, die Stärkung regionaler und überregionaler Netzwerke sowie die aktive Einbindung von Zivilgesellschaft und Wissenschaft.
Die Ergebnisse machen deutlich: Eine zukunftsfähige Medienbildung erfordert mehr als punktuelle Projekte. Sie muss rechtlich, institutionell und finanziell abgesichert sowie eng mit Demokratieförderung und Gesellschaftsthemen verknüpft werden.
3. Beitrag der Medienpädagogik zur Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders
Die Umfrage hebt hervor, dass Medienpädagogik einen zentralen Beitrag zur Förderung von Zusammenhalt, Demokratie und Resilienz in einer komplexen Mediengesellschaft leisten kann. Sechs zentrale Wirkungsfelder wurden benannt:
- Medienkompetenz und kritisches Denken
Medienpädagogik stärkt Analyse- und Reflexionsfähigkeit, befähigt zu kritischem Umgang mit Medieninhalten und fördert digitale Zivilcourage, Empathie und Kommunikationsfähigkeit. Eigene Medienproduktion dient dabei als Schlüssel zur Kompetenzentwicklung. - Bildung und Strukturen
Wirksamkeit erfordert die frühzeitige und durchgängige Verankerung von Medienbildung entlang der gesamten Bildungskette. Fachkräftequalifizierung, curriculare Vorgaben und die Vernetzung mit Politik, Kultur und Sozialpädagogik sind dafür entscheidend. - Soziale Teilhabe und Inklusion
Medienpädagogik schafft Räume für Partizipation, Sichtbarkeit und Empowerment. Sie fördert Inklusion, baut Barrieren ab, stärkt den intergenerationellen Dialog und ermöglicht chancengerechte Zugänge zu Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe. - Demokratie- und politische Bildung
Als Werkzeug gegen Hass, Populismus und antidemokratische Strömungen eröffnet Medienpädagogik Räume für Aufklärung, Mitgestaltung und demokratische Erfahrung. Sie fördert Meinungsbildungsprozesse, Perspektivenvielfalt und Diskursfähigkeit. - Wertebildung und ethische Orientierung
Medienpädagogik regt Auseinandersetzungen über moralische und gesellschaftliche Fragen an. Sie stärkt Empathie, soziale Verantwortung und respektvollen Umgang im digitalen Raum und macht Macht- sowie Interessensstrukturen transparent. - Rahmenbedingungen
Um ihr Potenzial auszuschöpfen, benötigt Medienpädagogik politische Rückendeckung, verlässliche Finanzierung und strukturelle Absicherung. Nur so kann sie als gestaltende Kraft in Bildungs- und Gesellschaftspolitik wirken und nachhaltige Veränderungen anstoßen.
Insgesamt zeigt sich: Medienpädagogik leistet weit mehr als reine Technikvermittlung. Sie ist eine Schlüsselressource für Inklusion, Demokratiebildung, Werteorientierung und kritische Gesellschaftsgestaltung – vorausgesetzt, ihre politische und strukturelle Absicherung wird gewährleistet.
4. Fazit: Fünf Kernforderungen
- Medienpädagogik strukturell, rechtlich und finanziell absichern
Medienpädagogik muss als verbindlicher Bestandteil aller Bildungsbereiche gesetzlich verankert werden – von der Kita über Schulen und außerschulische Einrichtungen bis zur Erwachsenenbildung. Dazu gehören eine dauerhafte Finanzierung, die Schaffung fester Personalstellen, verein-fachte und faire Förderverfahren, verlässliche Zuständigkeiten für IT und Beratung sowie bundesweite Qualitätsstandards. - Bildungspersonal qualifizieren und medienpädagogisch stärken
Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften, Erzieher*innen und weiteren Fachkräften muss flächendeckend medienpädagogische Inhalte vermitteln – in enger Verzahnung mit politischer und kultureller Medienbildung. Unterstützt werden sollte dies durch (OER-)Materialpools, Austauschformate und Netzwerke. Es muss Standard werden, dass in den Einrichtungen multiprofessionelle Teams mit Medienpädagogischer Qualifizierung arbeiten. - Medienpädagogik als Demokratie-, Inklusions- und Wertebildung begreifen
Medienpädagogik soll gezielt kritische Medienkompetenz, ethisches Urteilsvermögen, digitale Zivilcourage und gesellschaftliche Verantwortung fördern. Sie muss vielfältige Perspektiven sichtbar machen, marginalisierte Gruppen empowern und Demokratiebildung durch partizipative Formate erlebbar machen – insbesondere in herausfordernden sozialen Kontexten. - Handlungsorientierte Medienpädagogik stärken und Begegnungsräume schaffen
Eigene Medienproduktion, kreative Projekte und intergenerationelle, interkulturelle Formate sollen Menschen befähigen, Medien aktiv und reflektiert zu nutzen. Dabei stehen Selbstwirksamkeit, soziale Teilhabe und Barrierefreiheit im Zentrum – besonders für benachteiligte Gruppen. Medienpädagogik fungiert als Brückenbauer in einer vielfältigen Gesellschaft. - Medienbildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sichtbar machen und vernetzen
Medienpädagogik muss interdisziplinär mit Politik, Kultur, Sozialarbeit und Wissenschaft verbunden werden. Es braucht öffentlichkeitswirksame Kampagnen, eine starke zivilgesellschaftliche Einbindung, regionale und überregionale Netzwerke sowie eine bildungspolitische Offensive, um Medienbildung als Schlüssel für Demokratie, Zusammenhalt und Zukunftsgestaltung zu positionieren.